Rund um die Räume: baurechtliche Vorgaben
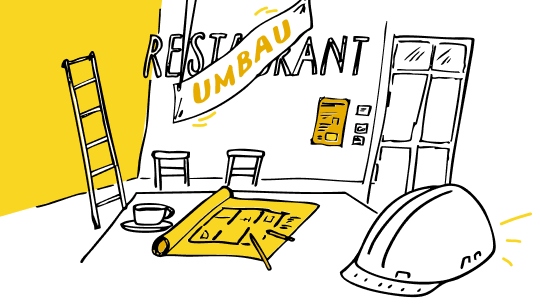
Zur Eröffnung und zum Betrieb einer Gastronomie müssen die Räumlichkeiten baurechtlich zugelassen sein. Je nach Bundesland ist zu prüfen, ob Bestandsschutz besteht. Ändert sich jedoch die Art des Betriebs, muss die Nutzungsänderung beim zuständigen Bauamt beantragt werden. Ebenso bei baulichen Veränderungen sowie bei Neubauten. Für die Beantragung müssen u.a. Baupläne und Baubeschreibungen eingereicht werden. In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass es aufgrund fehlender Genehmigungen oder nachträglich zu erbringender baulicher Anpassungen (Sicherheit, Hygienevorschriften etc.) zu Verzögerungen kommt. Nicht übersichtlicher macht es die Tatsache, dass die baurechtlichen Regelungen an vielen verschiedenen Stellen festgelegt werden.
Brandschutz und Fluchtwege
Durch geeignete bauliche Maßnahmen wie feuerbeständige Wände und Decken sowie die Installation von Brandmelde- und Löschanlagen ist der Brandschutz sicherzustellen. Zur Umsetzung der spezifischen Anforderungen ist eine Abstimmung mit dem Bauamt sowie der örtlichen Feuerwehr notwendig. Fluchtwege müssen abhängig von der Betriebsgröße und der maximalen Personenanzahl in entsprechender Menge vorhanden, gekennzeichnet und beleuchtet sein sowie ständig freigehalten werden. Einen Brandschutzleitfaden gibt es hier.
Lüftungsanlagen für Gastraum und Küche
Sowohl im Gastraum als auch in der Küche muss gemäß den technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) stets eine „ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft“ vorhanden sein. Ist hierfür eine raumlufttechnische Anlage erforderlich, muss sie jederzeit funktionsfähig sein. Störungen muss die Anlage automatisch melden können, sodass Schutzmaßnahmen für Mitarbeitende und Gäste getroffen werden können. Durch die Belüftung darf kein Raumzug entstehen. Ablagerungen und Verunreinigungen müssen umgehend beseitigt werden, damit kein Gesundheitsrisiko entsteht. Für die Lüftung in gewerblichen Küchen gilt überdies die Norm DIN EN 16282 (Großküchengeräte – Einrichtungen zur Be- und Entlüftung von gewerblichen Küchen). Details hierzu finden sich in der Arbeitssicherheitsinformation (ASI) 2.19 der BGN.
Personalräume
Ob man einen Personalraum benötigt, hängt von individuellen Faktoren ab. Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und die dazugehörigen Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) legen grundsätzlich fest, dass Arbeitgeber ab zehn Mitarbeitenden geeignete Räume bereitstellen müssen. Jedoch kann auch ein zumutbarer alternativer Aufenthaltsbereich – etwa ein ruhiger Bereich im Restaurant – anerkannt werden. Wird im Dienst – etwa in der Küche, je nach Konzept aber auch im Service – Arbeitskleidung getragen, sind dafür Umkleideräume zur Verfügung zu stellen.

Sanitäre Anlagen
Sowohl für die Gäste als auch für das Personal ist eine bestimmte (Mindest-)Anzahl von Toiletten bereitzustellen, getrennt nach Geschlechtern und ggf. inklusive barrierefreier Einrichtungen. Wie hoch die Anzahl ist, hängt von der Menge der vorhandenen Sitzplätze ab. Ab fünf Mitarbeitenden müssen in der Regel nach Geschlechtern getrennte Toilettenräume vorhanden sein, die ausschließlich den Betriebsangehörigen zur Verfügung stehen.
Barrierefreiheit
Ob der Betrieb eine barrierefreie Toilette – u.a. rollstuhlgerecht, mit unterfahrbarem Waschbecken und Notrufsystem - vorweisen können muss, hängt von verschiedenen Kriterien ab, zum Beispiel
- den Vorgaben/ Landesbauordnungen des jeweiligen Bundeslandes (eine Übersicht gibt es hier)
- der Betriebsgröße (je nach Land müssen in der Regel nur größere Betriebe barrierefreie Sanitäranlagen vorweisen)
- ob es ein Neubau bzw. ein wesentlicher Umbau ist (dann in der Regel vorgeschrieben) oder ein Alt- bzw. Bestandsbau (keine generelle Pflicht)
- ggf. dem Erhalt öffentlicher Fördermittel, der oft Barrierefreiheit vorschreibt
Näheres regelt das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG).
Sondernutzungserlaubnis für Außenflächen
Die Sondernutzungserlaubnis im öffentlichen Straßenraum regelt das Straßen- und Wegerecht der einzelnen Bundesländer. Grundsätzlich gilt: Wer den Gehweg vor der Gastronomie, Plätze oder andere öffentliche Freiflächen nutzen möchte, benötigt dazu eine (gebührenpflichtige) Sondernutzungserlaubnis. Oft müssen Lagepläne oder Skizzen für die Inanspruchnahme der Fläche mit eingereicht werden. Da die Satzungen für diese Sondernutzung kommunal festgelegt werden, ist eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit der zuständigen Behörde (z.B. Straßenverkehrsbehörde, Ordnungsamt oder Tiefbauamt) ratsam.
Lärmschutz
Immer wieder kommt es aufgrund von hoher Lautstärke zu Beschwerden, Klagen, Bußgeldern oder gar dem Entzug der Gewerbeerlaubnis. Betreiber sind gemäß § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) verpflichtet, Lärm zu vermeiden oder zu beschränken. Doch wann ist laut zu laut? Die Grenzwerte sind abhängig von der Gebietsausweisung (Wohngebiet, Gewerbegebiet); Ruhezeiten (v.a. Nachtruhe) und Sperrzeiten werden kommunal festgelegt. Zur Kontrolle der Emissionswerte werden, etwa nach Beschwerden, Lärmmessungen vorgenommen und infolgedessen können geräuschreduzierende bauliche Maßnahmen (z.B. Schallschutzwände) angeordnet werden. Details dazu finden sich in der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm.




